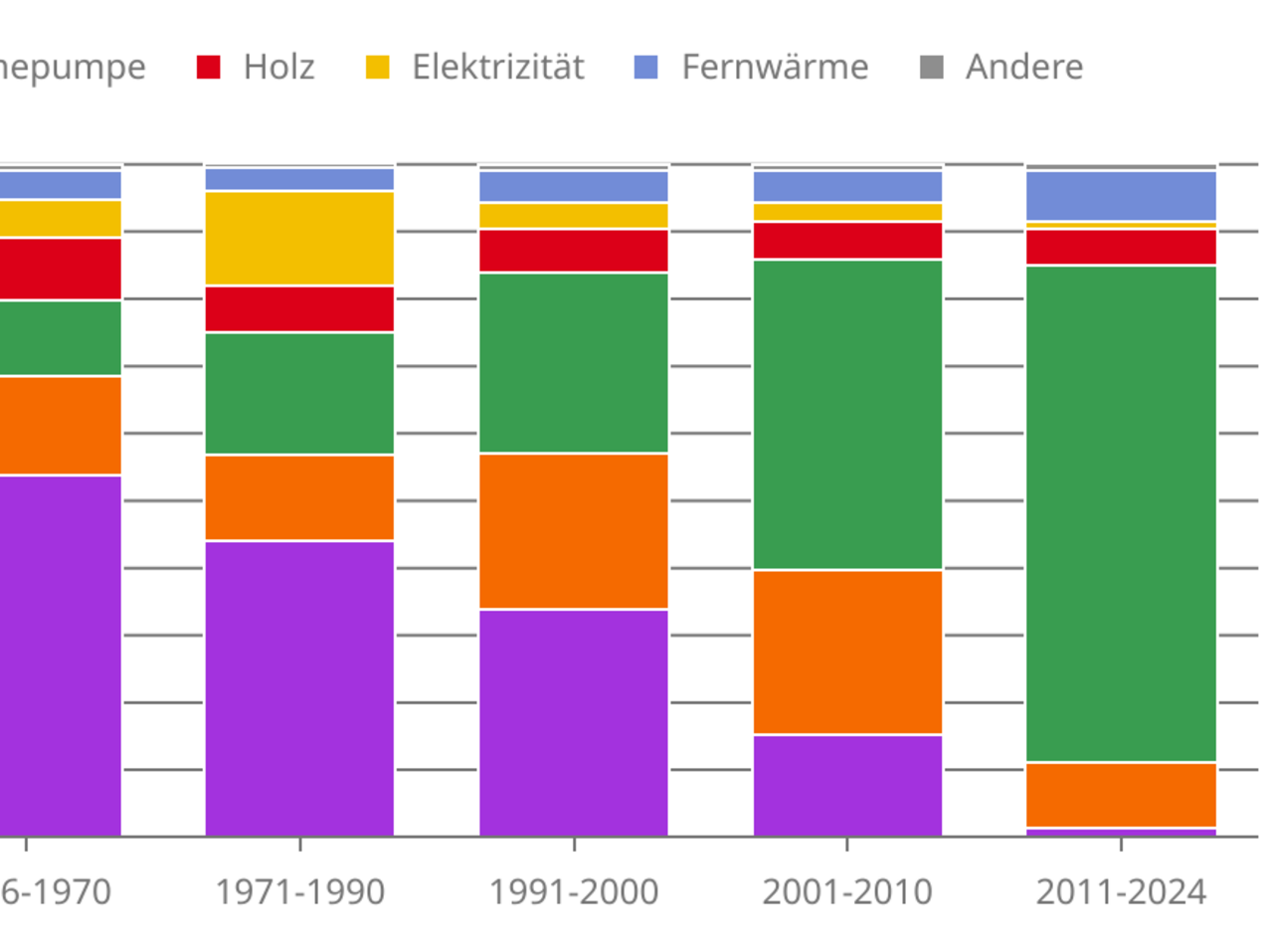Quelle: Rüger R. Sellin
Rüdiger R. Sellin
Noch unverzichtbar: Schweizer AKWs
Bis nach dem Zweiten Weltkrieg wurde die Schweiz zu fast 100 % mit heimischer Wasserkraft versorgt. Der Aufschwung führte ab 1950 zum Bau grosser Wasserkraftwerke und ab 1960 zur Erstellung neuer Atomkraftwerke, die seit 2019 sukzessive abgestellt werden. Woher der Strom künftig kommen soll, ist völlig offen.
Ab den 1960er Jahren entstanden europaweit Hunderte und in der Schweiz vier Atomkraftwerke (AKW) mit fünf Reaktoren. Dies war damals noch ohne grossen Widerstand möglich, denn Atomstrom galt als billig, praktisch und problemlos. Über die Herkunft und Endlagerung gebrauchter und radioaktiver Brennstäbe machte man sich erst viel später Gedanken, etwa nach Atomunfällen. Derzeit betreibt die Schweiz mit Beznau 1 und 2, Gösgen und Leibstadt vier aktiv laufende Atomreaktoren.
Grundlast durch AKW
Bis heute sind Atomkraftwerke (AKW) ein wichtiger Pfeiler der schweizerischen Stromversorgung. Sie trugen 2020 rund 35,2 % zur Schweizer Stromproduktion bei und sind zur sicheren Erbringung der konstant notwendigen Grundlast unverzichtbar. 2023 waren es gemäss Statistik zwar nur 23,3 %, was wohl mit Revisionsarbeiten an den Beznauer Reaktoren begründet ist.
Ob sich Atomstrom wirklich günstig produzieren lässt, ist umstritten. Nach Angaben der Betreiber liegen die Gestehungskosten auch heute noch bei nur vier und sechs Rappen pro KWh, womit die Atomenergie zu den preisgünstigsten Stromproduktionsmethoden der Schweiz zählt. Atomkraftkritiker bemängeln, dass die Kosten für sicherheits- und altersbedingte Umrüstungen sowie für die dereinstige Ausserbetriebnahme und den Rückbau nur unzureichend berücksichtigt würden. Denn die effektiven Kosten seien meist höher als die zu diesem Zweck gebildeten und gesetzlich vorgeschriebenen Rückstellungen. Atomkraftbetreiber hingegen widersprechen dem und beteuern, dass die gebildeten Rückstellungen ausreichend seien.
Heimische AKWs
Fakt ist, dass AKWs lokal kein CO2 emittieren. Sie wurden in der EU u. a. auf Druck von Frankreich als klimaschonend eingestuft. In der Schweiz liefern die heimischen AKWs Strom für rund drei Mio. Bewohner. Zurzeit sind noch vier AKWs in Betrieb:
Beznau 1: Druckwasserreaktor von Westinghouse, 365 MW Leistung (seit 1969)
Beznau 2: Baugleich zu Beznau 1, 365 MW Leistung (seit 1972)
Gösgen: Druckwasserreaktor von Siemens, 1010 MW Leistung (seit 1979)
Leibstadt: Siedewasserreaktor von General Electric (BWR-6), 1233 MW Leistung (seit 1984)
Das Kernkraftwerk Mühleberg war von 1972 bis 2019 am Netz und betrieb dazu einen Siedewasserreaktor von General Electric (BWR-4) mit 373 MW Leistung.
Zusammen erzeugen die Schweizer Atomkraftwerke jährlich rund 22 Mia. KWh Strom, was etwa dem Verbrauch sämtlicher Schweizer Haushalte entspricht. Im Winter kann der Anteil der AKWs bis auf die Hälfte der heimischen Stromproduktion ansteigen. Einen höheren AKW-Anteil im Strommix als die Schweiz weisen im langjährigen europäischen Vergleich Frankreich, Belgien, die Slowakei, Slowenien, Schweden und Ungarn auf. Jener von Slowenien und Schweden ist etwa gleich hoch wie der schweizerische.
AKWs weltweit
Atomenergie trägt rund 10 % zur weltweiten Stromproduktion bei. Ende 2022 umfasste der Kernkraftwerkspark insgesamt 438 Reaktoren in 33 Ländern. Davon decken 13 Länder inklusive der Schweiz mehr als ein Viertel oder 19 von 36 OECD-Ländern ihren Strombedarf mit Atomkraftwerken. In der EU beträgt der nukleare Anteil an der Stromproduktion 25 %. 2022 gingen dort sechs neue Einheiten ans Netz, fünf wurden stillgelegt. Die USA erzeugten im selben Jahr mit 92 Reaktoren (zwei stehen in Bau) den meisten Atomstrom, dies vor China (55), Frankreich (56) und Russland (37 Reaktoren).
Deutschland nahm im Frühjahr 2023 die letzten drei Reaktoren ausser Betrieb, obwohl diese noch jung waren und erst die Hälfte ihres Lebenszyklus erreicht hatten. Diese sogenannte «Energiewende» war von der Regierung Merkel so gewollt, weil die Stimmung in Deutschland 2011 nach dem verheerenden Atomunfall in Japan endgültig gegen AKWs umschlug. Trotzdem investieren die meisten Länder mit AKWs weiterhin in diese vermeintlich «saubere Technologie». So standen Ende 2022 weltweit 57 AKWs in Bau, 18 davon allein in China. Weitere gut 100 sind geplant.
Dies hängt mit dem Ende des Lebenszyklus vieler AKWs aus den 70er und 80er Jahren zusammen, die nun ersetzt werden müssen. In Frankreich ist Atomstrom eine Art Exportschlager, wobei 2021 28 von 56 AKWs in Revision oder aus Sicherheitsgründen abgeschaltet waren, viele davon übrigens nahe an der Grenze zur Schweiz. Dies führte zum Bau der Gaskraftwerke in Brugg für den Fall einer Stromlücke im Winter, währenddem die Schweiz seit Jahrzehnten Winterstrom u. a. aus französischen AKWs bezieht.
«AKW-frei» – und doch nicht ganz
Besonders kurios verliefen die Arbeiten und die Politik rund um das AKW Zwentendorf an der Donau (Niederösterreich). Es wurde ab 1972 gebaut und plangemäss fertiggestellt, ging aufgrund einer entsprechenden Volksabstimmung 1978 mit etwas über 50 % Nein-Stimmen jedoch nie ans Netz. Das AKW gilt als grösste Investitionsruine der Republik Österreich sowie als Markstein der Wirtschaftsgeschichte.
So blieb Österreich als eines der ganz wenigen westlichen Länder «AKW-frei». Ursprünglich plante Österreich drei AKWs, was jedoch durch das Atomsperrgesetz vom Dezember 1978 und weitere Gesetze seit 1999 verunmöglicht wird. Zur endgültigen Abkehr von AKWs hat auch der dramatische Atomunfall von Tschernobyl/Ukraine im April 1986 beigetragen, bei dem ein Kraftwerksblock explodierte, was auch in Österreich zu messbaren Strahlenbelastungen führte.
Es ist zu erwähnen, dass Österreich in der Folge nach der Nichtinbetriebnahme des AKWs Zwentendorf Atomstrom aus Tschechien importierte, was damals rund 15 % des gesamten Strombedarfs Österreichs ausmachte. Heute liegt der Anteil bedeutend tiefer, da noch mehr Strom mit Gross- und Klein-Wasserkraftwerken erzeugt wird. Gleichwohl wird besonders im Winter immer noch Strom aus osteuropäischen AKWs importiert.
«Ausstieg vom Ausstieg» in Deutschland
Zwischen 1957 und 2004 wurden in West- und Ostdeutschland rund 110 kerntechnische Anlagen in Betrieb genommen. Ab den späten 1970er Jahren gaben sie den Impuls zur Gründung der Grünen Partei, welche die Umweltbewegungen sammelte und sich den Trend gegen Atomkraft zunutze machte. Ein genereller Ausstieg aus der Atomkraft zur Stromerzeugung wurde erstmals im Jahr 2000 unter der rot-grünen Bundesregierung von Altbundeskanzler Schröder gesetzlich festgelegt und mit den Energiekonzernen vertraglich geregelt. Im s. g. «Atomkonsens» wurde ausgehend von einer Regellaufzeit von rund 32 Jahren bestimmt, welche «Reststrommenge» ein Atomkraftwerk vor seiner Stilllegung noch produzieren darf. Aus diesen «Reststrommengen» folgte, dass im Jahr 2021 das letzte von 19 deutschen Kernkraftwerken stillgelegt würde.
Doch die politischen Verhältnisse wechselten mehrfach. Im Oktober 2010 beschloss der Bundestag unter der Regierung Merkel ein neues Atomgesetz mit einer Laufzeitverlängerung. Danach sollten die Betriebszeiten der vor 1980 in Betrieb gegangenen sieben Anlagen um je acht Jahre und jene der zehn übrigen Atomkraftwerke um je 14 Jahre verlängert werden, was spöttisch als «Ausstieg aus dem Ausstieg» bezeichnet wurde. Im Gegenzug verpflichten sich die Energiekonzerne zur jährlichen Zahlung von je 300 Mio. € in den Jahren 2011 und 2012 und von je 200 Mio. € bis 2016. Damit sollte der Energie- und Klimafonds finanziert werden. Noch 2011 wurden diese Planungen nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima nochmals revidiert und der generelle Ausstieg aus der Energieerzeugung mit AKWs beschlossen. So gingen die letzten drei AKWs Emsland, Isar 2 und Neckarwestheim 2 im April 2023 vom Netz.
Nuklearkatastrophe von Fukushima
Am 11. März 2011 um 14.46 Uhr ereignete sich im Nordpazifik ein Erdbeben der Stärke 9 – 130 km von Japan entfernt. Es löste eine gigantische Flutwelle von bis zu 30 m Höhe aus, die eine Stunde später auf die japanische Küste traf. Sie überflutete 500 km2 Land, verursachte den Tod von 20 000 Menschen, zerstörte 250 000 Gebäude und 22 000 Fischerboote und machte 200 km2 Landwirtschaftsfläche für längere Zeit unbrauchbar. Der auf das Erdbeben folgende Tsunami setzte das Hauptkühlsystem des Kernkraftwerks Fukushima Daiichi ausser Betrieb, wodurch die Kerne der Reaktoren 1, 2 und 3 schmolzen und sich das Abklingbecken von Reaktor 4 überhitzte.
In den folgenden Tagen wurde eine grosse Menge an Radioaktivität aus den ausgefallenen Reaktoren der Kernanlage freigesetzt. Die terrestrische Ablagerung betraf hauptsächlich jene Regionen in bis zu 30 km Entfernung von den Anlagen sowie eine Landzunge, die sich mehr als 40 km in nordwestlicher Richtung erstreckt. Mehr als 160 000 Personen mussten als Folge des Unfalles evakuiert werden.
Kehrtwende danach
Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima änderte sich die Atompolitik auch hierzulande dramatisch. Noch im Februar 2011 stimmten im Rahmen einer Konsultativabstimmung die Berner Bürger/-innen über den Ersatz des AKWs Mühleberg ab – mit knappem Ergebnis. So standen am Ende 188 193 Ja-Stimmen 179 279 Nein-Stimmen gegenüber. Der damalige BKW-Direktor Kurt Rohrbach zeigte sich mit dem Ausgang der Abstimmung zufrieden: «Das Berner Volk hat sich für die Versorgungssicherheit entschieden.»
Doch nur einen Monat später kippte die Stimmung dank Fukushima gewaltig, ebenso wie die Position einiger bürgerlicher Politiker, welche mehr oder weniger schnell realisierten, dass man mit «Pro AKW» künftig keine Wählerstimmen mehr generieren kann. Auch die damalige Bundesrätin Doris Leuthard (CVP), ab 1999 bis zur Wahl in den Bundesrat im Jahr 2006 immerhin gewählte Nationalrätin aus dem «Atomkanton Aargau», ehemalige Verwaltungsrätin einer Axpo-Tochter und bis 2018 Bundesrätin, setzte sich dediziert für einen schnellen Atomausstieg ein.
Im November 2016 wurde die unterdessen lancierte Atomausstiegsinitiative von den Schweizer Stimmbürgern trotzdem mit 54,2 % Nein-Stimmen abgelehnt. Sie wollte den Bau neuer AKWs in der Schweiz verbieten und die Laufzeiten bestehender Schweizer AKWs begrenzen. Bundesrat und Parlament hatten sie zur Ablehnung empfohlen, weil damit eine übereilte Abschaltung verbunden gewesen wäre. Bundesrat und Parlament setzen im Rahmen der Energiestrategie 2050 auf einen schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie.
Erster Rückbau im bernischen Mühleberg
Mühleberg als erstes Schweizer AKW wurde Ende 2019 nach jahrelangen technischen Problemen und fortgesetzten Demonstrationen stillgelegt. Offiziell hiess es ab etwa 2013 seitens BKW, dass Mühleberg aus wirtschaftlichen Gründen abgeschaltet würde. Immer schärfere und immer neue Auflagen seitens der Aufsichtsbehörden minderten die Rendite und die Lust auf Weiterbetriebe, wiewohl die BKW jahrelang viele Millionen Franken in die alte Anlage investiert hatten. Anfang 2020 begann deren Rückbau, der nach Angaben der Bernischen Kraftwerke (BKW) plangemäss verläuft. Stark radioaktive Komponenten aus dem Inneren des Reaktors wurden unter Wasser zerlegt und verpackt. Ab 2022 wurden die Brennelemente ins zentrale Zwischenlager (Zwilag) in Würenlingen transportiert, sodass in Mühleberg seit Anfang 2025 keine Brennelemente mehr vorhanden sind.
Aktuell werden verbliebene Anlageteile demontiert, die mit Radioaktivität in Kontakt gekommen sind, etwa der Reaktordruckbehälter, Teile des Sicherheitsbehälters oder das nicht mehr benötigte Brennelementlagerbecken. Alle demontierten Komponenten werden im Maschinenhaus sortiert, falls möglich gereinigt, auf Radioaktivität überprüft und verpackt. Gereinigtes und freigegebenes Material wird als normaler Abfall deponiert oder nach Möglichkeit wiederverwertet.
Gemäss Planungen der BKW soll der ehemalige AKW-Standort Ende 2030 frei von radioaktivem Material sein. Wenn nach einer genauen Kontrolle keine radiologischen Gefahrenquellen mehr festgestellt werden, geben die Behörden das Gelände für eine neue Nutzung frei. Abhängig davon, ob das Areal künftig industriell oder naturnah genutzt wird, werden die restlichen Gebäude abgebrochen, wozu die BKW ab 2027 eine entsprechende Baugenehmigung einreichen will. Der Bauschutt aus diesem konventionellen Rückbau wird entweder auf Deponien entsorgt oder wiederverwertet, womit das Areal ab 2034 neu genutzt werden kann.
Rückbaukosten
Über die Kosten eines AKW-Rückbaus gehen die Schätzungen weit auseinander. Nach Angaben des AKW-Betreiberverbandes Swissnuclear im Oktober 2021 kosten Stilllegung und Rückbau der Schweizer Atomkraftwerke (AKW) inklusive Entsorgung aller Abfälle rund 23,1 Mia. CHF. Gemäss Verband sind die Gesamtkosten damit um 1,1 Mia. CHF oder 4,5 % tiefer als bei der letzten Schätzung 2016, wo man noch von 24,2 Mia. CHF ausging. Erfahrungen aus der Stilllegung des AKWs Mühleberg hätten gezeigt, dass Nachbetriebsarbeiten und Stilllegungsarbeiten auch parallel ausgeführt werden können, so Swissnuclear.
Die Stilllegungskosten von neu rund 3,7 Mia. CHF sanken gegenüber 2016 um 3 %. Die Entsorgungskosten seien sogar um 5 % gesunken und betragen beim Bau von je einem Lager für schwach- und hochaktive Abfälle an zwei unterschiedlichen Standorten neu 19,4 Mia. CHF. Das Verfüll- und Versiegelungskonzept sei weiterentwickelt und die Zugangsbauwerke und Verpackungsanlagen optimiert worden, sagt Swissnuclear. Von den Gesamtkosten seien 7,5 Mia. CHF bereits bezahlt und weitere 8,9 Mia. CHF durch die vom Bund kontrollierten Rücklagefonds sichergestellt. Knapp drei Viertel der Gesamtkosten seien laut Swissnuclear somit ausfinanziert, wobei man aus dem Fondsvermögen noch Kapitalerträge in Höhe von 4,9 Mia. CHF erwarte.
Scharfe Kritik
Die Schweizerische Energiestiftung übt scharfe Kritik an der Darstellung von Swissnuclear. Die AKW-Betreiber «wälzen die noch immer hohen Kostenrisiken auf die Allgemeinheit ab», und dies auch noch «wider besseres Wissen». Tiefenlager für radioaktive Abfälle seien «eine Geschichte sehr teurer Misserfolge». Würden die Risiken verursachergerecht berücksichtigt, müssten die Kosten deutlich ansteigen, statt zu sinken, sagt die von privaten Spendengeldern finanzierte Stiftung. Der Zuschlag, um eine zu optimistische Kostenschätzung abzufedern, sei gemäss international vergleichbaren Bauprojekten viel zu tief, und unerwartete Ereignisse würden nicht berücksichtigt.
Ausserdem sei es mit einer absichtlichen Insolvenz in Form von Atomkraftwerken, die als separate Gesellschaften organisiert sind, nach wie vor möglich, dass die Eigentümerkonzerne späteren Beitragserhöhungen und der gesetzlichen Nachschusspflicht und Solidarhaftung entgehen. Zudem sei die im Entsorgungskonzept vorgesehene Langzeitbeobachtung nach dem Verschluss der Endlager in den Kosten nicht berücksichtigt.
Wieder neue Schweizer AKWs?
Seit Annahme der Energiestrategie 2050 im Oktober 2017 verfolgt die Schweiz einen schrittweisen Ausstieg aus der Kernenergie. Die bestehenden Schweizer AKWs dürfen trotz ihres Durchschnittsalters von über 40 Jahren quasi «auf Zusehen» hin bis zu ihrem altersbedingten Ende laufen, dürfen aber nicht durch neue Anlagen ersetzt werden. Dies solle der Schweiz die für den Umbau der Energieversorgung nötige Zeit verschaffen, hiess es damals. Nun mehren sich hingegen die Stimmen, wonach man sich alle Türen in Richtung neuer AKWs wieder offenhalten wolle. Ob dies politisch durchsetzbar ist, darf jedoch bezweifelt werden.