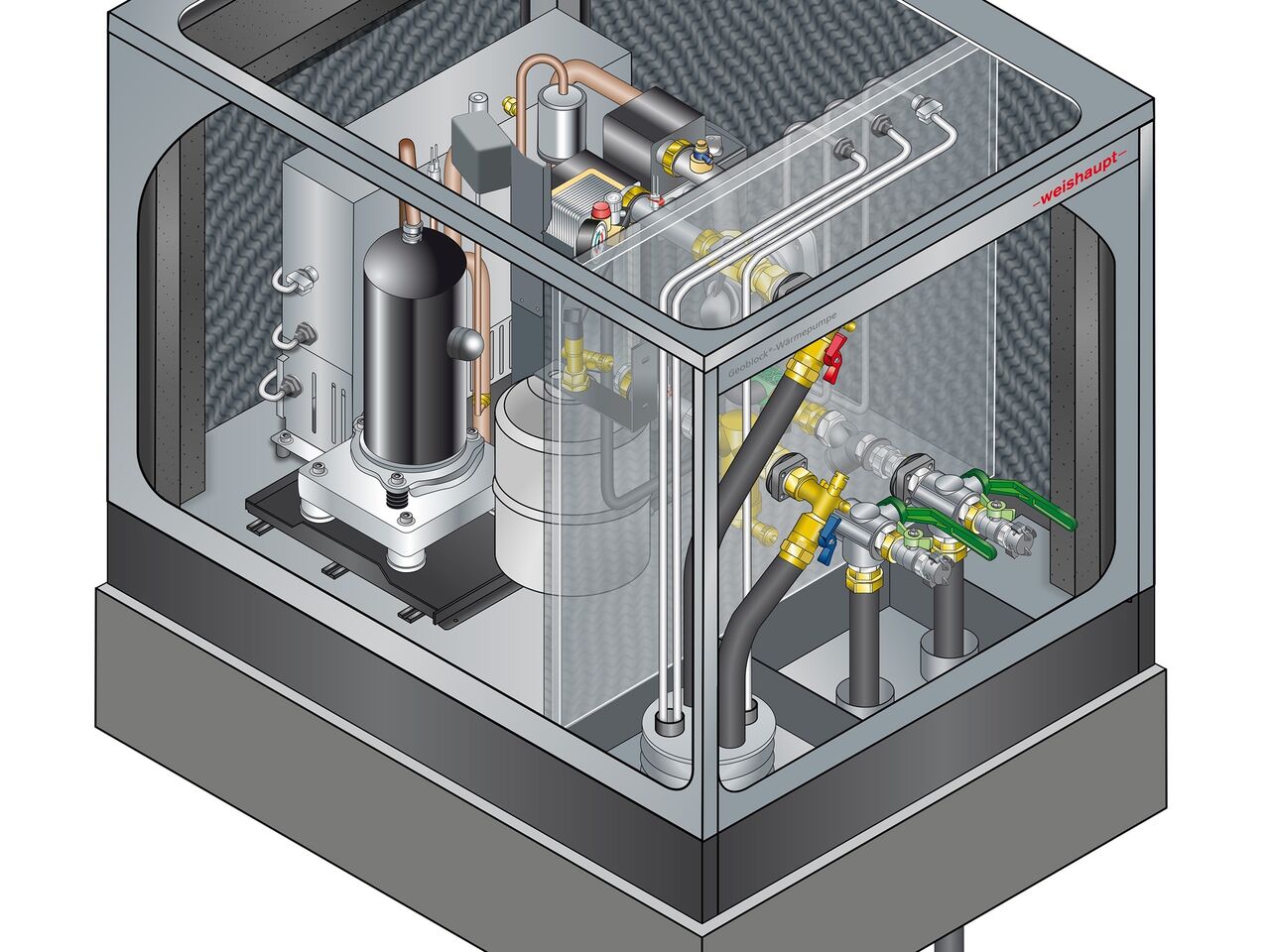Hans kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause. Die Tür zu seiner Wohnung öffnet sich automatisch, nachdem die Wohnung seine Identität per kombinierter Gesichts- und Stimmerkennung geprüft und bestätigt hat. «Willkommen zu Hause, Hans», begrüsst ihn eine warme, freundliche Stimme – computergeneriert und KI-gesteuert. Als er den Küchenbereich betritt, geht das Licht an; im Eingangsbereich wird es gleichzeitig gedimmt. Die Kaffeemaschine beginnt, seinen Lieblingskaffee zuzubereiten. So wie er ihn gern hat, jeden Abend nach der Arbeit. Ein Blick auf das Display am Kühlschrank zeigt zwei Menüvorschläge, erstellt aufgrund der Vorräte, die im Kühlschrank, im Gefrierer und im Reduit lagern. Er bestätigt die Spaghetti bolognese. Eine Meldung erscheint, dass dafür 200 Gramm Hackfleisch fehlen. Hans bestätigt die Bestellung und setzt gleich noch eine Dubai-Schokolade und ein Bier auf die Einkaufsliste. Heute ist Fernseh-Abend. Die Bestellung wird direkt an den Supermarkt um die Ecke geschickt, in etwa 30 Minuten wird das Ganze von einer Drohne geliefert – und dann von einem Kochroboter, in den man nur noch die Zutaten füllen muss, zubereitet. Mit seinem Kaffee in der Hand setzt sich Hans aufs Sofa. Sofort erwacht der Bildschirm zum Leben und zeigt die neusten Nachrichten. Ein etwas aufdringliches Surren kündigt einen Anruf an. Seine Mutter. Sie ist 89 und lebt noch immer zu Hause. Das Smarthome und seine Helferlein machen es möglich. «Annehmen», sagt Hans. Sofort teilt sich der Bildschirm, neben den Nachrichten erscheint das Bild seiner Mutter. Sie sprechen über Gott und die Welt und über die Sonnenstoren, die nach dem letzten Update nicht mehr wie gewohnt funktionieren. Oh, es klingelt, die Spaghetti sind bereit!
Die Summe der Einzelteile
Wenn man seiner Fantasie freien Lauf lässt, kann man sich gut vorstellen, dass wir im Jahr 2050 so oder so ähnlich leben: In Smarthomes, die auf die Vorlieben ihrer Bewohnenden reagieren; die sogar auf der Basis dieser Vorlieben und von Verhaltensmustern vorausschauend agieren; die mit der Umwelt kommunizieren; die den Bewohnenden abnehmen, was keinen Spass macht, und das Wohnen zu Hause in jeder Hinsicht optimieren. Warum auch nicht? Schliesslich ist vieles, was uns Science-Fiction-Filme vor 30 und mehr Jahren als futuristisch verkauft haben, mittlerweile fast schon normal geworden. Roboterunterstützung in Haushalt und Garten? Check! Geräte, die sich mit der Stimme steuern lassen? Check! Videocalls an grossen Bildschirmen? Schon fast ein alter Hut. «In ähnlicher Weise wie im Automobilbau ist auch im Bereich des häuslichen Wohnens ein zunehmender Trend zur Automation von Funktionalitäten und zur internen und externen Vernetzung festzustellen», heisst es denn auch auf der Website des Fraunhofer-Instituts für Naturwissenschaftlich-Technische Trendanalysen INT. Allerdings sei man «von einer durchgängigen Implementierbarkeit von allen oder auch nur vielen der damit verbundenen Möglichkeiten und von einer vollständigen Interoperabilität und Vernetzung aller möglichen Einzellösungen» noch weit entfernt. Oder anders formuliert: Smarthomes sind heute oft ein Stückwerk aus Elementen, deren Ganzes noch nicht so viel mehr ist als die Summe seiner Einzelteile.
Utopisch oder dystopisch?
Ob sich das in den nächsten 25 Jahren ändern wird? Andrew Paice ist Leiter des iHomeLab, dem Kompetenzzentrum für Gebäudeintelligenz der Hochschule Luzern. Für ihn geht die künftige technische Entwicklung grundsätzlich in zwei Richtungen: Die Menschen können irgendwann beschliessen, Künstlicher Intelligenz und intelligenten Maschinen im wahrsten Sinn des Worts den Stecker zu ziehen, weil sie zu übermächtig werden. Oder die Menschen überlassen der KI das Feld und geniessen das Leben ohne lästige Alltagsverpflichtungen. Dystopie oder Utopie, das wird die Frage sein. «Aber wir werden sie sicherlich nicht bis 2050 beantworten», sagt Andrew Paice. «Denn die Vorhersagen vieler KI-Experten scheinen mir zu optimistisch.» Es sei ganz normal, dass Neues sich erst einmal sprunghaft und optimistisch entwickelt, ohne dass der Mensch über Einschränkungen und Grenzen nachdenkt. «Die KI ist momentan Versuchung und Pandoras Büchse zugleich, und viele Menschen wissen im Grund gar nicht richtig, was sie damit anfangen sollen.» Dann komme der Punkt, an dem der Mensch merkt, dass nicht jede Taschenlampe über KI verfügen muss, und die Entwicklungskurve abflacht. Andrew Paice glaubt, obwohl fasziniert von den Möglichkeiten der KI, dass KI vor allem als Aktivitätsbeschleuniger dienen und weniger eine eigenständige Intelligenz werden wird.
Weit weg vom Ökosystem
Für Andrew Paice begann die Entwicklung von Smarthomes mit der Frage: Was wäre, wenn wir Dinge im Haus miteinander verbinden können? «Da sind wir mittlerweile so weit, dass eigentlich alle Interessierten im Baumarkt kaufen können, was sie brauchen», sagt er. Problematisch sei, dass sich daraus noch kein eigentliches Ökosystem einrichten lasse – zumindest nicht ohne viel Aufwand. «Ich kenne nur ganz wenige Homes, die umfassend smart sind», sagt Andrew Paice. «Ein Besitzer eines solchen konsequenten Smarthomes erzählte mir, er habe ein Jahr gebraucht, um alles korrekt einzurichten und zu programmieren.» Vielleicht, so der Experte, werde es in naher Zukunft möglich sein, mithilfe von KI-Vorschlägen einfacher zu umfassenderen Smarthome-Ökosystemen zu kommen. «Dann müssen wir nur noch die Frage beantworten, ob das Home an sich die nötige Steuerungsintelligenz besitzen soll oder die einzelnen Elemente für sich intelligent sind.»
Mehr Komfort
Für den iHomeLab-Leiter gibt es drei Argumente für ein gutes Smarthome: Ressourcenmanagement, Sicherheit und Komfort. Für ihn ist klar, dass die Automatisierung mühsamer oder unangenehmer Dinge im Haushalt voranschreiten wird, während jene Dinge, an denen man Spass hat, in menschlicher Hand bleiben werden. Andrew Paice erzählt als Analogie eine persönliche Anekdote: «Mein Vater kaufte meiner Mutter ihren ersten Geschirr-spüler in einer Zeit, als die Nachbarn von Schwarz-Weiss- auf Farbfernsehen umstiegen. Meine Mutter fragte sie, wie das Farbfernsehen sei, und bekam zur Antwort: Es wäscht kein Geschirr.» Je weiter die Automatisierung voranschreitet, desto höher wird aber auch der Energiebedarf. Ein einzelner Saugroboter mag nicht ins Gewicht fallen; 2 Milliarden solcher Geräte allerdings durchaus. Dieser Energiebedarf, so der Experte, könnte der flächendeckenden Entwicklung des Smarthomes Grenzen setzen, auch wenn daran gearbeitet wird, IoT-Geräte mit immer weniger Energieversorgung auskommen zu lassen.
Getrübte Kristallkugel
Georges T. Roos beschäftigt sich von Berufs wegen mit der Zukunft. Der Zukunftsforscher räumt ein, dass ein detaillierter Blick in die Kristallkugel schwierig ist. «Man kann Potentiale recht zuverlässig umschreiben, die spezifischen Umsetzungen aber kaum», sagt er. Zu viele technische, politische, gesellschaftliche, regulatorische Unwägbarkeiten, die jetzt noch gar nicht vorhersehbar sind, spielen hierbei eine Rolle. «Und wir wissen ja auch gar nicht, ob ein technischer Durchbruch mit einem Schlag alles verändern kann.» Absehbar ist immerhin, dass sich gewisse Megatrends – langfristige Entwicklungen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit unser Leben in absehbarer Zukunft bestimmen werden – auch in künftigen Smarthomes niederschlagen werden.
Technik im Hintergrund
Ein solcher Megatrend ist, dass die Bevölkerung immer älter wird. Bis 2050 wird über ein Viertel der Bevölkerung über 65 Jahre alt sein, der Anteil der über 80-Jährigen wird sich im Vergleich zu heute verdoppelt haben. «Ich bin überzeugt, dass Smarthomes, Smart Services und Dienstleistungsroboter eine wichtige Rolle spielen werden, damit Seniorinnen und Senioren so lang wie möglich in den eigenen vier Wänden leben können», sagt Georges T. Roos. Sicherheitsmassnahmen, wie sie heute bereits erhältlich sind, werden sich beträchtlich weiterentwickeln; die Wohnung wird merken, wenn etwas nicht so ist wie gewohnt, und einen Alarm auslösen. Auch Assistenzsysteme, die alltägliche Arbeiten erleichtern oder gar selbstständig erledigen, haben ein grosses Potential. Der Roboterstaubsauger ist nur der Anfang einer solchen Entwicklung. «Wichtig ist jedoch, dass die Technologie nicht im Vordergrund steht», sagt Georges T. Roos. «Ich hörte einmal das Bonmot: ‹Wir nennen nur jene Dinge Technologie, die noch nicht richtig funktionieren.› Das finde ich sehr passend.» Damit sich Smart Living im Seniorenbereich oder überhaupt flächendeckend durchsetzt, müsse es so einfach, unauffällig und zuverlässig funktionieren wie ein Lichtschalter, den heute wohl niemand mehr als Technologie bezeichnen würde. «Wenn man wie heute noch mit Smartphones hantieren muss und bei Update-Ankündigungen hofft, dass anschliessend alles noch funktioniert, wird es schwierig.» Auch die Steuerung müsse intuitiv, also sprachgesteuert, möglich sein. Mit Maschinen zu sprechen, so der Zukunftsforscher, werde normal sein.
KI zum Plaudern?
Immerhin: Eine grundsätzliche Ablehnung gegen smarte Helferlein, wie sie heute noch zu finden ist, wird es bis in 25 Jahren wohl nicht mehr geben. Auch nicht gegen Assistenzsysteme wie Pflegeroboter, die heute eher skeptisch beäugt werden. «Es gibt jetzt schon zu wenig Pflegende», sagt Georges T. Roos, «und das wird sich in Zukunft kaum ändern. Eine robotergestützte Hilfe könnte durchaus dazu führen, dass sich Pflegende in Zukunft auf spezielle Anforderungen und zwischenmenschliche Bedürfnisse konzentrieren könnten.» Überhaupt, das Zwischenmenschliche: Machen Smarthomes, die einem irgendwann alles abnehmen und auch das Arbeiten von zu Hause aus ermöglichen, die Menschen nicht einsam? Schliesslich müsste man die eigenen vier Wände dann ja gar nicht mehr verlassen. «Im Gegenteil, ich glaube, dass Künstliche Intelligenz bis zu einem gewissen Grad der Einsamkeit entgegenwirken kann», sagt der Zukunftsforscher. Ein Ersatz für zwischenmenschliche Kontakte könne KI zwar nicht sein, aber immerhin ein Lückenfüller in Situationen, wo zwischenmenschlicher Kontakt nicht möglich ist. Ob dieser Ersatz Alexa heisst oder im Rahmen eines virtuellen Raums abläuft, wird sich zeigen.
Der Mensch bleibt am Drücker
Auch wenn viele Elemente eines Smarthomes der Zukunft – man denke nur an das Energiemanagement – voll automatisiert ablaufen werden: Georges T. Roos ist fest davon überzeugt, dass es immer einen menschlichen «Override» braucht. «Man darf nicht vergessen: Wenn Menschen gar keine Aufgaben mehr haben, können sie leicht die Orientierung verlieren», sagt Georges T. Roos, «besonders wenn sie es ein Leben lang gewohnt waren, einen Haushalt selbst zu führen.» Smarte Einrichtungen und Dienste müssen deshalb vom Menschen frei aktivier- und deaktivierbar sein; man dürfe der Technik nicht ausgeliefert sein. «Es kann ja nicht sein, dass ich zu Hause friere, nur weil das Gebäude findet, dass 19,5 °C vom energetischen Standpunkt aus ideal seien», so der Zukunftsforscher. «Aber ich gehe nicht davon aus, dass wir 2050 voll automatisiert durchs Leben gehen werden – auch wenn Dinge wie das Energiemanagement grundsätzlich automatisch im Hintergrund geregelt werden.»
So wirds – vielleicht
Wie stellt sich der Zukunftsforscher ein Smarthome im Jahr 2050 vor? «Ausgehend von dem, was ich mir wünsche: eine Wärmesteuerung nach meinen Bedürfnissen; Elemente, die es mir erlauben, auch im hohen Alter zu Hause zu sein; ein smartes Sicherheitssystem; Assistenzsysteme für den Alltag; Künstliche Intelligenz im Kühlschrank und der Vorratskammer; die Möglichkeit, Dinge per Sprachsteuerung statt an kleinen oder grossen Bildschirmen zu erledigen – denn Bildschirme sind ja eigentlich sehr unnatürlich.» Wir werden in 25 Jahren nachfragen, wie es gekommen ist!